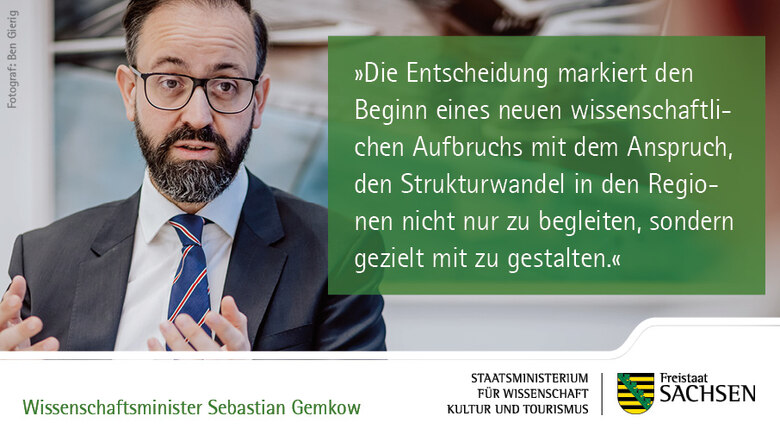Zwei neue Großforschungszentren in der sächsischen Lausitz und im mitteldeutschen Revier
In der sächsischen Lausitz und im mitteldeutschen Revier werden in den nächsten Jahren zwei neue Großforschungszentren mit internationaler Strahlkraft etabliert, um herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anzuziehen, die exzellente Forschung mit Blick auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen betreiben.
Das Deutsche Zentrum für Astrophysik (DZA) in der sächsischen Lausitz und das Center for the Transformation of Chemistry (CTC) im Mitteldeutschen Revier haben sich im wissenschaftsgeleiteten Wettbewerb »Wissen schafft Perspektiven für die Region«, den das Bundesministerium für Bildung und Forschung gemeinsam mit dem Freistaat Sachsen ausgerufen hatte, durchgesetzt. Zentrale Zielstellung des durchgeführten Wettbewerbsverfahrens für die Großforschungszentren war und ist es,
- durch deren strukturelle und thematische Ausrichtung zu einer langfristigen Stärkung des gesamten Wissenschafts- und Innovationsstandorts Deutschland beizutragen,
- durch eine enge Vernetzung mit regionalen Hochschulen und Unternehmen wesentlich zur nachhaltigen Entwicklung des regionalen Standortes beizutragen, das wirtschaftliche Wachstum und die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen zu fördern,
- in besonderem Maße Transfer und die Förderung des Innovationsgeschehens in der Region, in Deutschland und in Europa zu unterstützen sowie
- neue zukunftsgerichtete Modelle der strukturellen Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft umzusetzen.
Die Großforschungszentren werden mit einem jährlichen Budget von bis zu je 170 Mio. EUR arbeiten können und sollen jeweils rund 1000 Arbeitsplätze schaffen. Mit der Ansiedelung an mehreren Standorten in der sächsischen Lausitz und im Mitteldeutschen Revier in den nächsten Jahren sollen sich die Großforschungszentren zu Treibern des Fortschritts entwickeln, verankert in den Landkreisen Bautzen, Görlitz und Nordsachsen.
Damit wird ein Beitrag zum Strukturwandel in den traditionellen Braunkohlerevieren geleistet.
Beide Zentren befinden sich aktuell in einer dreijährigen Aufbauphase, die vom BMBF mit jeweils bis zu 40 Mio. EUR gefördert wird. Damit werden der Aufbau der Organisationsstrukturen, die Entwicklung der wissenschaftlichen Konzepte, die Erarbeitung von Betriebs-, Personal- und Transferstrategien, die temporäre Unterbringung in Büro- und Laborräumen, die Gründung der Zentren mit eigener Rechtsform und Governance ermöglicht. Ab 2026 ist der Übergang in eine institutionelle Förderung durch den Bund, den Freistaat Sachsen und im Falle des CTC zusätzlich durch das Land Sachsen-Anhalt geplant. Schwerpunkte werden dann neben exzellenter Forschung vor allem die Ausgründung von Unternehmen und Start-ups. Parallel dazu werden die Baumaßnahmen für eine dauerhafte Unterbringung in Form eines Wissenschaftscampus durchgeführt.
Das Deutsche Zentrum für Astrophysik wird von Prof. Dr. Günther Hasinger, dem ehemaligen wissenschaftlichen Direktor der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, geführt. Die Astrophysik ist eine Hightech-Wissenschaft mit großer Innovationskraft. Gleitsichtbrillen, Zeranfelder, wesentliche Bestandteile von Mobiltelefonen, Navi oder schnelle elektronische Banküberweisungen via Satellit wären ohne astronomische Forschung undenkbar. Dabei ist das Portfolio des DZA so vielfältig, dass es Jobs im wissenschaftlichen, aber noch deutlich mehr im nicht-wissenschaftlichen Bereich schaffen wird.
Das Center for the Transformation of Chemistry wird geführt von Prof. Dr. Dr. h.c. Peter H. Seeberger vom Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung. Die zukünftige Versorgung Deutschlands und der Europäischen Union mit Chemikalien und Pharmazeutika muss durch lokale, kostengünstige und nachhaltige Produktionsprozesse hauptsächlich aus nachwachsenden Rohstoffen oder recycelten Materialien mit höchsten Arbeitsschutz- und Umweltstandards und drastisch verkürzten Transportwegen sichergestellt werden. Voraussetzung dafür ebenso wie für die Erreichung europäischer Klimaziele, wirtschaftlichen Wohlstandes und zukunftssicherer Beschäftigungschancen in der Region, ist die strukturierte und langfristig ausgerichtete Transformation der Chemie, also der Kerngedanke des CTC.
Deutsches Zentrum für Astrophysik
Center for the Transformation of Chemistry
Hintergrund:
Am 14. August 2020 ist das »Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen« (StStG) für die durch den Kohleausstieg betroffenen Reviere in Kraft getreten. Um neue Perspektiven für die Kohleregionen zu schaffen, sieht das StStG in § 17 Ziffer 29 die »Gründung je eines neuen institutionell geförderten Großforschungszentrums nach Helmholtz- oder vergleichbaren Bedingungen in der sächsischen Lausitz und im mitteldeutschen Revier auf Grundlage eines Wettbewerbsverfahrens« vor. Aus dem Strukturstärkungsgesetz stellt der Bund bis einschließlich 2038 je 1,1 Milliarden Euro pro Zentrum bereit.
Für die Festlegung der inhaltlichen Ausrichtung hatten das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), der Freistaat Sachsen und das Land Sachsen-Anhalt einen zweistufigen themenoffenen Wettbewerb »Wissen schafft Perspektiven für die Region!« durchgeführt. Start des Wettbewerbs war im November 2020. Bis zum 30. April 2021 lief ein Ideenwettbewerb, der sich an herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im In‑ und Ausland richtete, die eine innovative Idee für ein neues Großforschungszentrum haben, und bereit sind, diese Idee zu einem tragfähigen Konzept weiterzuentwickeln und vor Ort umzusetzen.
Interessierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren dazu aufgerufen, ihre Ideen zunächst in Form einer Konzeptskizze beim BMBF einzureichen.
Diese sollte u. a. Folgendes enthalten:
- Eine ambitionierte Forschungsmission, die den Bogen von der Grundlagenforschung bis hin zur Anwendung spannt.
- Ein innovatives Konzept zur Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft (inkl. einer Transferstrategie).
- Ein Vorschlag für einen möglichen Kern an Ressourcen (inkl. Personal).
Die internationale Ausschreibung ist auf große Resonanz gestoßen: Über 200 Ideengeber, davon mehr als ein Fünftel aus dem Ausland hatten sich mit fast 100 Projektskizzen beteiligt. Diese decken eine große Bandbreite von Themen ab.
Die eingereichten Konzeptskizzen wurden durch eine hochrangige Perspektivkommission unter dem Vorsitz von Herrn Prof. Herrmann bewertet. Im Juli 2021 wurde durch eine hochrangig besetzte Perspektivkommission aus den eingereichten Anträgen die sechs überzeugendsten ausgewählt:
- Chemresilienz (Prof. Seeberger, Potsdam): Um die Versorgung wichtiger Industriezweige wie Gesundheit, Verkehr, Energie, Landwirtschaft und Konsumgüter sicherzustellen, will »Chemresilienz – Forschungsfabrik im Mitteldeutschen Revier« eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft chemischer Erzeugnisse etablieren. Nachwachsende Rohstoffe, kurze Transportwege sowie lokale, kostengünstige und nachhaltige Produktionsprozesse sollen die Resilienz der deutschen Chemiewirtschaft sicherstellen – bei gleichzeitiger Einhaltung höchster Arbeitsschutz- und Umweltstandards.
- CLAI_RE (Prof. Teutsch, Leipzig): Das »Centre for Climate Action and Innovation – Research and Engineering« (CLAI_RE) will Klimadaten und -wissen bündeln. Auf dieser Basis sollen funktionale digitale Zwillinge von Ökosystemen geschaffen werden und Datenräume in ganz neuen Dimensionen entstehen. CLAI_RE will Handlungsoptionen für den Klimaschutz mit Fokus auf Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasser, Planung urbaner Räume, Energieversorgung, Gesundheit und Mobilität entwickeln.
- CMI (Prof. Meiler, Leipzig): Die Initiatorinnen und Initiatoren des »CMI – Center for Medicine Innovation« nehmen neue Technologien zur Digitalisierung und Individualisierung der Medizin in den Fokus. Durch die Vereinigung von Medizintechnik, Digitalisierung und Medikamentendesign soll ein Zentrum der biomedizinischen Forschung und personalisierten Medizin entstehen. Versorgungs- und Wertschöpfungsketten sollen zu einem Ökosystem vereint werden, das die Integration neuer Produkte in Versorgungstrukturen erleichtert und beschleunigt.
- Deutsches Zentrum für Astrophysik (Prof. Hasinger, European Space Agency Spanien): In Sachsen sollen die riesigen Datenströme zukünftiger Großteleskope gebündelt und verarbeitet werden. Gleichzeitig sollen in einem neuen Technologiezentrum u.a. Regelungstechniken für Observatorien entwickelt werden. Dabei bauen die Verantwortlichen auf die Erfahrung und das moderne Umfeld der Industrie in Sachsen auf. Zudem wird die Option verfolgt, in den Granitformationen der Lausitz ein Gravitationsteleskop zu bauen.
- ERIS (Prof. Drebenstedt, Freiberg): Das »European Research Institute for Space Ressources« – kurz ERIS – will wissenschaftliche und technologische Grundlagen für die Errichtung und den Betrieb von Weltraumstationen auf Mond und Mars erforschen. Auf dieser Basis will ERIS Lösungsansätze für gesellschaftlich relevante Herausforderungen auf der Erde entwickeln. Aus Sicht der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können neue Methoden und Technologien einen Beitrag dazu leisten, Ressourcen im Weltraum und auf der Erde sicherer, effektiver und umweltschonender zu nutzen.
- LAB (Prof. Curbach, Dresden): Das »Lab – Lausitz Art of Building« adressiert einen Paradigmenwechsel im Bauwesen: neue, ressourceneffiziente und klimaneutrale Werkstoffe sowie modular geplante, hochflexible und lange nutzbare Bauwerke sollen den enormen Ressourcenverbrauch im Bauwesen mindern. Das Konzept integriert die modernsten Ansätze der Materialforschung, der Produktionstechnologien und der Digitaltechnologien, sodass sich die Lausitz als arbeitsplatzwirksame europäische Modellregion für nachhaltiges Planen und Bauen entwickeln kann.
Die Autorinnen und Autoren der sechs Skizzen hatten sechs Monate Zeit, ihre Ideen in tragfähige und umsetzungsreife Konzepte für große Forschungszentren zu entwickeln. Sie erhielten dafür bis zu 500.000 Euro. Die in Förderphase I ausgearbeiteten Konzepte wurden durch externe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler begutachtet. Auf dieser Basis haben Bund und das Sitzland über die Förderung der beiden besten Konzepte entschieden.
Begleitet wurde das Verfahren von einer Perspektivkommission mit Vertretern aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Innovation und Gesellschaft. Die Perspektivkommission hatte die Aufgabe, mögliche Antragsteller gezielt anzusprechen, die Konzeptskizzen zu begutachten sowie Empfehlungen zur Ausgestaltung der Konzepte auszusprechen. Die Perspektivkommission traf ihre Empfehlung, welche der eingereichten Konzeptskizzen weiterverfolgt und eine Förderung zur weiteren Ausarbeitung erhalten sollen, anhand folgender Kriterien:
- Überregionale Bedeutung und langfristige Relevanz des Forschungsthemas
- Erwarteter Beitrag zum Strukturwandel in der Region
- Innovationspotential für den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Deutschland, einschließlich des Potentials für neue Wege der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
- Erfolgsaussichten und Möglichkeit eines raschen Aufbaus
Vorsitz
- Professor Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang A. Herrmann, Präsident Emeritus der Technischen Universität München
Mitglieder
- Professorin Dr. Katja Becker, Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft
- Anna Maria Braun, Vorsitzende des Vorstands der B. Braun Melsungen AG
- Professorin Dr. Martina Brockmeier, Internationaler Agrarhandel und Welternährungswirtschaft, Universität Hohenheim
- Dr. Alexander Gerst, Deutscher ESA-Astronaut
- Dr. Andrea Grimm, Mitglied des Aufsichtsrats der IBM Deutschland GmbH
- Professor Dr. Detlef Günther, Vizepräsident für Forschung der ETH Zürich
- Professorin Dr. Katharina Hölzle, Leiterin des Fachgebiets IT-Entrepreneurship am Hasso-Plattner-Institut, Digital Engineering Fakultät der Universität Potsdam
- Professor Dr. Dr. h.c. mult. Stefan Hell, Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie und am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung
- Dr. Carsten Mahrenholz, Gründer und CEO der Coldplasmatech GmbH
- Professorin Dr. Patrycja Matusz, Vizepräsidentin für Internationale Beziehungen und Projekte der Universität Breslau
- Professor Dr. Georg Milbradt, Ehemaliger Ministerpräsident des Freistaats Sachsen
- Dr. Jeanne Rubner, Leiterin der Redaktion »Wissen und Bildung aktuell« des Bayerischen Rundfunks
- Professor Dr.-Ing. habil DEng Dr. h.c. mult. Hans Müller-Steinhagen, Präsident der Dresden International University
- Professor Dr. Dr. h.c. Joachim Sauer, Senior Researcher am Institut für Chemie der Humboldt Universität zu Berlin
- Dr. Eric Weber, Gründer und CEO von spinlab, Accelerator der Handelshochschule Leipzig